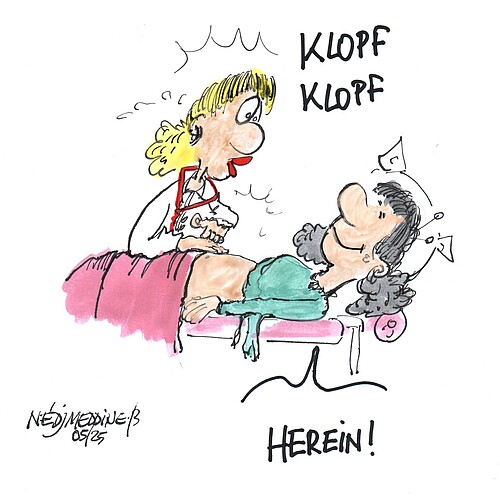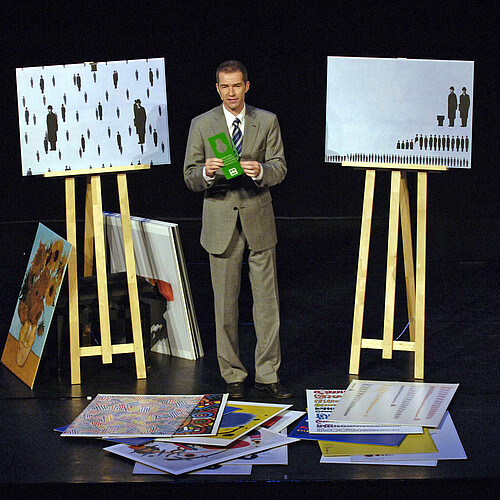- Fokus: Humor
Humor: eine kleine Einführung
Was verstehen wir unter Humor? Welche Wirkung können verschiedene Formen von Komik im Spitalalltag haben? Und was sagen die Witze, die wir lustig finden, über unsere Persönlichkeit aus?
10.06.2025

Es gibt keinen einheitlichen Gebrauch des Wortes «Humor» in der heutigen Literatur. Seine Bedeutung ist unter anderem abhängig davon, in welchem terminologischen Bezugssystem man sich bewegt. Für mich persönlich hat Humor mit einem «[…] persönlichkeitsbedingten kognitiv-emotionalen Stil der Verarbeitung von Situationen bzw. des Lebens, der Welt im Allgemeinen zu tun, der charakterisiert ist durch die Fähigkeit, auch negativen Situationen (Gefahren, Ich-Bedrohungen etc.) positive Seiten abzugewinnen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ja sogar darüber lächeln zu können, d. h. zumindest ansatzweise mit ‹Erheiterung› zu reagieren» [1]. Damit sehe ich Humor in Abgrenzung zu anderen Komikstilen wie Witz, Nonsens, Spass, Ironie, Satire, Sarkasmus oder Zynismus. Vergleicht man diese acht Komikstile, zeigen sich folgende Resultate: Die Komikstile Sarkasmus und Zynismus sind einander am ähnlichsten; sie erzeugen interpersonelle Distanz und verletzen. Zudem bilden sie mit der Ironie und der Satire – beide haben kognitive Anteile, die den Spott mildern – das «dunkle» Cluster.
Im «hellen» Bereich sind die verspielten Formen Nonsens (Spiel mit Sinn und Unsinn) und Spass (Scherz, Streich) einander ähnlich und von den anspruchsvolleren Stilen Humor (enthält Tugend) und Witz (Esprit, verbale Intelligenz, Kreativität) zu unterscheiden. Spass, Witz, Humor und Nonsens gehen mit positiven Emotionen einher [2].
Im Gegensatz dazu versteht die moderne angloamerikanische Humorforschung «Humor» als Sammelbegriff für alles, was erheitert oder zum Lachen bringt. In diesem Bezugsrahmen kann Humor auch «aggressiv» sein, rassistisch, tabubrechend oder sexistisch und deckt das ganze oben beschriebene Spektrum von hell bis dunkel ab.
Lachen und Lächeln: ein kraftvolles Duo
Lachen und Lächeln sind nicht nur Ausdruck von Freude, sie wirken auch als soziale Bindemittel. Studien haben gezeigt, dass Lachen das Stresslevel senken kann, indem Endorphine freigesetzt werden. Gleichzeitig fördert ein Lächeln die Beziehung zum Gegenüber und kann die Stimmung aufhellen. Besonders in herausfordernden Momenten, wie sie im Krankenhausalltag häufig vorkommen, kann dies entscheidend sein.
Bereits eine geringfügige Humorintervention kann den Verlauf einer medizinischen Untersuchung positiv beeinflussen und die Arzt-Patienten-Beziehung verbessern. Patientinnen nahmen an einer der routinemässigen Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen teil und waren entweder einer humorvollen Intervention ausgesetzt oder erhielten eine Standardbrustuntersuchung. In der Humorgruppe wurde die normale Visitenkarte durch eine selbst gemalte, humorvolle Visitenkarte ersetzt, die den Patientinnen zu Beginn der Untersuchung ausgehändigt wurde. Anschliessend wurden sie mit einem standardisierten Fragebogen befragt. Die Patientinnen der Humorgruppe erinnerten sich besser an den Namen des Radiologen, schätzten das Abschlussgespräch mit ihm mehr, empfanden ihn als einfühlsamer und bewerteten ihn als humorvollen Arzt. Darüber hinaus zeigten Patientinnen in der Humorgruppe tendenziell weniger Angst und empfanden den Arzt als kompetenter. Geringe Ursache führt zu einer grossen Wirkung; eine Verbesserung der Beziehung zwischen Patientin und Radiologe [3].
Die Rolle von Humor im Spitalalltag
Im Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten stellt sich heraus, dass Humor, insbesondere schwarzer Humor und Zynismus, im Gesundheitswesen weit verbreitet ist. Dieser Humor scheint oft als Bewältigungsmechanismus in stressreichen Situationen zu fungieren. Angesichts der belastenden Umstände, unter denen medizinisches Personal arbeitet, bietet er die Möglichkeit, mit der Schwere ihrer Aufgaben umzugehen. Humor kann hier als Ventil dienen, das Druck abbaut und eine gewisse Normalität in Ausnahmesituationen schafft.
Ärztinnen und Ärzte neigen dazu, einen sogenannten «beruflichen Humor» zu kultivieren, der sich von gängigem Humor unterscheidet. Dieser Humor steht oft in direktem Zusammenhang mit den alltäglichen Herausforderungen im Gesundheitswesen und dient der emotionalen Entlastung.
Unterschiede zwischen Humorstilen
Obwohl es im Krankenhausalltag ein weit verbreitetes Verständnis für verschiedene Humorarten gibt, sind die Unterschiede in ihrer Funktion entscheidend. Schwarzer Humor kann in kritischen Situationen helfen, während Zynismus oft eine negative Perspektive fördern kann, die die zwischenmenschliche Kommunikation und das Teamklima strapazieren könnte. Es ist wichtig, zwischen Humor zur Entspannung und Humor, der andere beleidigt oder schädigt, zu unterscheiden.
Humor als Stressbewältigung
Hier stellen sich die Fragen: Ist Humor immer eine gesunde Bewältigungsstrategie? Und wo zieht man die Grenze? Humor kann sehr wohl als ein gesundes Mittel zur Stressbewältigung dienen, indem er eine emotionale Distanz zu belastenden Situationen schafft. Jedoch kann übermässiger Gebrauch von Zynismus und schwarzem Humor die emotionale Erschöpfung fördern und ein Gefühl der Isolation auslösen.
Es ist entscheidend, dass Humor im Spitalumfeld achtsam eingesetzt wird. Der Unterschied zwischen einem als positiv empfundenen Spass und verletzendem Witz ist oft nur gering. Es gilt, den Humor als wertvolles Werkzeug zu kultivieren und sich gleichzeitig bewusst zu sein, wann es Zeit zum Rückzug ist.
Angst vor dem Lachen
Seit einigen Jahren wird auch Gelotophobie, die Angst vor dem Ausgelachtwerden, untersucht [4]. Manche Personen haben das Lachen eher als Waffe und weniger als entspannte gemeinsame Aktivität erlebt. Es wird angenommen, dass diese Personen in ihrer Kindheit, ihrer Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter ausgelacht beziehungsweise verspottet wurden, was traumatisch wirken kann. Für gelotophobe Personen ist jedes Lachen ein bösartiges Lachen [5]. So können Betroffene beispielsweise auch dem freundlichen Lächeln eines Therapeuten misstrauen und gehen zu keinem zweiten Termin, da sie sich nicht ernst genommen fühlen [6].
Witze als Hinweis auf Persönlichkeitsmerkmale
Humor im Alltag ist sehr komplex, von vielen Faktoren abhängig und daher schwierig zu studieren. Manche Mechanismen kann man aber bereits bei Witzen und Cartoons erforschen. Es gibt zwei charakteristische Phasen bei der Verarbeitung von humoristischem Material, die in der Vergangenheit beispielsweise mit «Verblüffung» und «Erleuchtung» bezeichnet wurden. Bei sogenannten Inkongruenz-Lösungs-Witzen verarbeitet die rezipierende Person in der Phase der «Inkongruenz» Informationen, bis sie durch ein nicht vorhersagbares, nicht stimmiges, inkongruentes Ende (die Pointe) überrascht wird. Dies motiviert die rezipierende Person, die Inkongruenz aufzulösen, d. h. den Witz zu verstehen. Während dieser «Lösungsphase» versucht sie, die Pointe stimmig zum vorhergehenden Teil zu machen.
Stereotype oder Nonsens?
Diese Lösung greift oft auf Stereotype zurück, z. B. die dumme Blondine, der geizige Schotte oder die böse Schwiegermutter. Erheiterung durch Witze mit Inkongruenz-Lösungs-Struktur korreliert mit Merkmalen, die generell das Vermeiden von Unsicherheit (und die Wertschätzung von Redundanz) im informationstheoretischen Sinne darstellen – also Konservativismus, Intoleranz von Ambiguität oder eine geringe Offenheit für neue Erfahrungen. Personen, die Inkongruenz-Lösungs-Witze mögen, schätzen auch Einfachheit und Symmetrie in der Kunst (Malerei, Literatur) und sind für Recht und Ordnung sowie für das Verhängen drastischer Strafen.
Die Inkongruenzen der Witze und Cartoons des zweiten Faktors (Nonsens) sind meist komplexer. Sie sind zudem entweder (real) nicht lösbar, oder ihre Lösung bringt neue Inkongruenzen mit sich, die wiederum nicht lösbar sind. Man denke da beispielsweise an Cartoons von Gary Larson oder Sketche von Monty Python. Die Vorhersage der Pointe ist unmöglich, weil sie sehr fantasievolle, manchmal auch absurde, real nicht existierende Ereignisse enthält. Die Inkongruenzen sind verblüffender, stärker und komplexer als jene des ersten Faktors. Das Mögen von Nonsens geht einher mit dem Wertschätzen von Informationsgehalt. Dies wird in Merkmalen wie Erfahrungssuche sowie Offenheit für Ästhetik und Ideen abgebildet. Eine Zusammenfassung der Forschung zeigt, dass Menschen, die Nonsens mögen, auch komplexe und fantastische Gemälde, komplexe Rasterbilder und Strichzeichnungen, komplexere Formen von Musik (Jazz und Klassik) sowie groteske Literatur lieben [7].
Abschliessende Gedanken
Dies ist nur ein Ausschnitt aus dem Bereich der aktuellen Humorforschung. Vor Jahrzehnten war Humor am Arbeitsplatz nicht angesagt. Man setzte sich damit der Gefahr aus, nicht seriös oder gar unreif zu sein. Ebenso war Humor kein Thema in der Forschung. Dies hat sich gelegt, und die Vorzüge von Humor werden erkannt. Die Anwendung von Humor ist jedoch eine Gratwanderung, da Komik auch negative Effekte haben kann. Wenn Humor zu Erheiterung führt, die man dazu noch mit anderen teilt, kann dies ein schönes gemeinschaftsstiftendes Erlebnis sein.
Literatur
- Ruch, W. (2016). Humor und Charakter. In: B. Wild (Hrsg.): Humor in Psychiatrie und Psychotherapie (2. Aufl.) (S 8–31). Stuttgart: Schattauer.
- Ruch, W., Wagner, L. & Heintz, S. (2018). Humor, the PEN model of personality, and subjective well-being: Support for differential relationships of eight comic styles. Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo (RISU), 1 (1), 31–44. https://www.risu.biz/wp-content/uploads/2018/01/Ruch_et_al.-RISU-11-2018-31-44-1.pdf (30.5.2025).
- Sartoretti, E., Sartoretti, T., Koh, D. M. et al. Humor in radiological breast cancer screening: a way of improving patient service? Cancer Imaging 22, 57 (2022). doi: 10.1186/s40644-022-00493-z.
- Ruch, W., Hofmann, J., Platt, T. & Proyer, R. T. (2014). The state-of-the-art in gelotophobia research: A review and some theoretical extensions. Humor: International Journal of Humor Research, 27, 23–45. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/86447/1/humor-2013-0046.aop.pdf (30.5.2025).
- Platt, T. & Ruch, W. (2009). The emotions of gelotophobes: Shameful, fearful and joyless? Humor: International Journal of Humor Research, 22, 91–110.
- Platt, T., Proyer, R. T., Hofmann, J., & Ventis, W. L. (2016). Gelotophobia in practice and the implications of ignoring it. The European Journal of Humour Research, 4(2), 46–56.